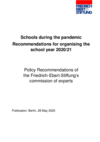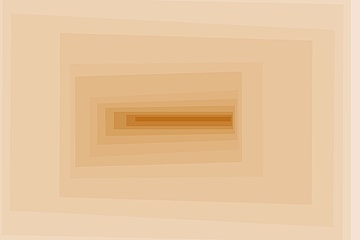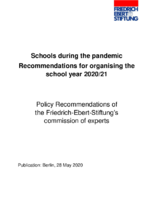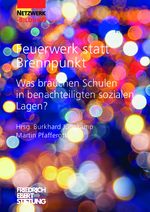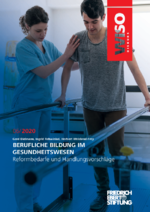Bildung und Wissenschaft

- Kontakt
Bildungs- und Hochschulpolitik
Martin Pfafferott
Martin.Pfafferott(at)fes.deBildungspolitik
Marion Stichler
Marion.Stichler(at)fes.deHochschulpolitik
Theresia Müller vom Berge
Theresia.Mueller-vom-Berge(at)fes.deStudienförderung
Bildungs- und Hochschulpolitik
Hiroshimastr. 17
10785 Berlin - Info
Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt Bildungsexpert_innen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft und Zivilgesellschaft ein.
- Bundes- und landespolitische Themen werden in Veranstaltungen miteinander diskutiert.
- thematisch-analytische Publikationen folgen hieraus.
- übergeordnete Fragestellungen werden als Studien bei Experten in Auftrag gegeben.
Schule in Zeiten der Pandemie: Empfehlungen für das Schuljahr 2020/21
Friedrich-Ebert-Stiftung stellt Ergebnisse der Kommission "Das Schuljahr 2020/21" vor
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen stellen eine Zäsur dar. Das trifft für das öffentliche Leben und für den Alltag vieler Menschen zu. In besonderem Maße gilt dies für den Bildungsbereich - und hier zuvorderst für die Schüler_innen, für ihre Eltern, für Lehrkräfte, Schulleitungen, für die Bildungspolitik und -verwaltung.
Sie alle haben mit großer Anstrengung und Engagement auf die sich so radikal und schnell verändernde Situation reagiert und unter schwierigsten Bedingungen kurzfristige Lösungen erarbeitet. Fest steht schon jetzt, dass darüber hinaus aber auch das kommende Schuljahr 2020/21 kein „normales“ werden wird.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat deswegen im Mai 2020 eine Kommission aus Expert_innen eingesetzt. Ihr Auftrag war, schon jetzt den Blick auf das nächste Schuljahr zu richten und konkrete Empfehlungen für verschiedene Handlungsfelder und Herausforderungen zu erarbeiten.
Vorsitzender der Kommission ist Prof. Dr. Kai Maaz, Geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Moderator der Kommission ist Burkhard Jungkamp, Staatssekretär a.D. und Moderator des Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
22 Expert_innen aus Bildungswissenschaften, Didaktik, Schulrecht, Medizin, Schulpsychologie, Schulverwaltung und kommunalen Vertretungen, Schulleiter_innen, Lehrkräfte, Schüler_innen und Eltern haben in gemischten Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen Empfehlungen erarbeitet, die in der vorliegenden Stellungnahme gebündelt sind.
Schule in Zeiten der Pandemie - Empfehlungen für die Gestaltung des Schuljahres 2020/21
Publikation herunterladen (290 KB, PDF-File)
Beiträge zu Bildung
Weitere Beiträge finden Sie hier.
Audio- und Videobeiträge
Unsere Netzwerke
Netzwerk Bildung
Martin Pfafferott
zur Website
Im Netzwerk Bildung treffen sich bildungspolitische Akteur_innen der Landes- und Bundesebene sowie Bildungsexpert_innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Der offene und konstruktive Dialog soll zu einem gemeinsamen Vorgehen in der Bildungspolitik beitragen. Schwerpunktthemen sind ganztägige Bildungseinrichtungen, frühe individuelle Förderung und längeres gemeinsames Lernen. Zu Fachthemen werden Publikationen herausgegeben.
Aufnahme in das Netzwerk Bildung ist nur durch Einladung möglich.
Netzwerk Wissenschaft
Martin Pfafferott
zur Website
Das Netzwerk Wissenschaft an deutschen Hochschulen entwickelt vor dem Hintergrund der Exzellenzinitiative Beiträge und Empfehlungen zur künftigen Gestaltung des deutschen Wissenschaftssystems.
Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik kommen zu informativen, handlungsleitenden Gesprächsrunden zusammen. Die Ergebnisse werden publiziert.
Aufnahme in das Netzwerk ist nur durch Einladung möglich.
Veranstaltungen
Webseminar 5: Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnen
Ausgehend von der Konferenz "Demokratie braucht Schule - Schule braucht Demokratie!" (2.9.2020) haben Fachkräfte der Berliner Schulen in der Webseminar-Reihe "Donnerstage für Demokratie" ab dem 3....
SV 2.0 - Coaching für SV-Teams und SV-Begleiter_innen
Gut organisierte SV-Teams sowie engagierte SV-Begleiter_innen sind der Kern aktiver SV-Arbeit. Nach der Wahl wissen viele Schülervertreter_innen nicht genau, was sie tun können und sollen. Das...
SV 2.0 - Coaching für SV-Teams und SV-Begleiter_innen
Gut organisierte SV-Teams sowie engagierte SV-Begleiter_innen sind der Kern aktiver SV-Arbeit. Nach der Wahl wissen viele Schülervertreter_innen nicht genau, was sie tun können und sollen. Das...
Publikationen
Achour, Sabine; Höppner, Anja; Jordan, Annemarie
Zwischen Status Quo und State of the Art
Berlin, 2020
Publikation herunterladen (2,8 MB PDF-File)
Schools during the pandemic - Recommendations for organising the school year 2020/21
Berlin, 2020
Publikation herunterladen (510 KB, PDF-File)
Feuerwerk statt Brennpunkt
Berlin, 2020
Publikation herunterladen (2,9 MB, PDF-File)
Schule in Zeiten der Pandemie - Empfehlungen für die Gestaltung des Schuljahres 2020/21
Publikation herunterladen (290 KB, PDF-File)
Dielmann, Gerd; Rehwinkel, Ingrid; Weisbrod-Frey, Herbert
Berufliche Bildung im Gesundheitswesen
Bonn, 2020
Publikation herunterladen (930 KB, PDF-File)
Bildung im Fokus
Aufstiegschancen
Das Aufstiegsversprechen lautet „Du kannst alles werden, was du willst.“ Wahr ist: Bildungserfolg hängt häufig vom Wohnort ab, vom Beruf und Bildungsabschluss der Eltern. Die Leistungen deutscher Schüler_innen im internationalen Vergleich haben sich verbessert und das Bildungssystem hat sich positiv entwickelt: Der aktuelle Bildungsbericht zeigt einen deutlichen Anstieg der Beteiligung im Kita- und Krippenbereich, den Ausbau der Ganztagsschulen, einen insgesamt gestiegenen Bildungsstand der Bevölkerung und mehr Studierende an den Hochschulen. Nicht geändert hat sich, dass soziale Herkunft den Bildungserfolg bestimmt. Insbesondere Kinder aus einkommensschwachen Familien sind benachteiligt. Insofern ist Armutsbekämpfung eines der effektivsten Mittel zur Bekämpfung von Ungleichheit.
Auch Gebührenfreiheit auf allen Ebenen sowie Leistungen wie das BAföG für Schüler_innen und Studierende spielen eine zentrale Rolle beim Abbau der Ungleichheit.
Gute Schulen
Klassische Unterrichtsmethoden wie Frontalunterricht können nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen. Der Umgang mit Unterschieden ist Kernaufgabe der Schule: Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem Alter, Religion und Geschlecht, Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Behinderung, mit Förderbedarf oder besonderen Begabungen finden sich in jedem Klassenzimmer. Guter Unterricht ist Unterricht, der individuell passt. Differenzierung kann im Tempo, im Niveau oder dem Ausmaß an Unterstützung erfolgen. Das ist komplex und anspruchsvoll. Für viele Lehrkräfte erfordert die Umstellung ein radikales Umdenken, das nur durch eine zweite Person im Klassenzimmer und multiprofessionelle Teams zu bewältigen ist. Dem steht akuter Mangel an Lehrer_innen gegenüber, der momentan durch Quereinsteiger bewältigt wird – ein Thema für die Aus- und Weiterbildung von Lehrer_innen.
Achtung, Digital Gap: Digitale Bildung und digitaler Wandel
40% aller Jugendlichen aus Familien mit geringerem sozioökonomischem Status erreichen nicht die Kompetenzen, die nötig wären, um erfolgreich an der Wissens- und Informationsgesellschaft teilzuhaben. Der DigitalPakt Schule soll deshalb ab 2019 für eine bessere digitale Ausstattung der Schulen sorgen. Auch in der beruflichen Ausbildung sind umfassende Anpassungen der Ausbildungsberufe nötig. An den Hochschulen eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Lehre. Auch in der Wissenschaft steht ein Umbruch bevor: Publikationswege und Forschung verändern sich. Open Access, Open Data, Open Source, Open Science und Citizen Science bergen Potenziale von mehr Transparenz, höherer Forschungsqualität und breiterer gesellschaftlicher Teilhabe.
Gezielt in Bildung investieren
Der Umbau zu einem deutlich besser ausgestatteten Bildungssystem mit einer neuen Lernkultur und Unterrichtsqualität sowie inklusiver Bildung wird weitere Zeit brauchen. Aber viele Schulen und Hochschulen zeigen, dass er möglich ist, und manche Bundesländer sind auf dem richtigen Weg. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ermöglicht zu allen genannten Themen und Schwerpunkten einen intensiven Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Schul- bzw. Hochschulpraxis.