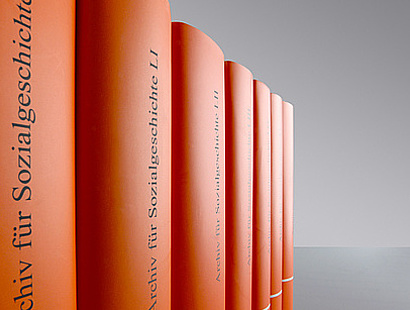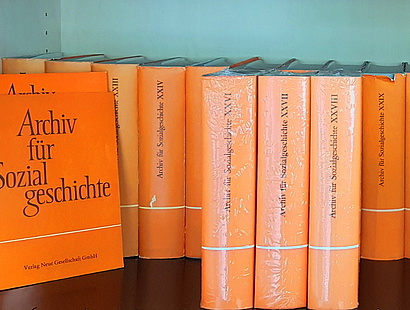Archiv der sozialen Demokratie
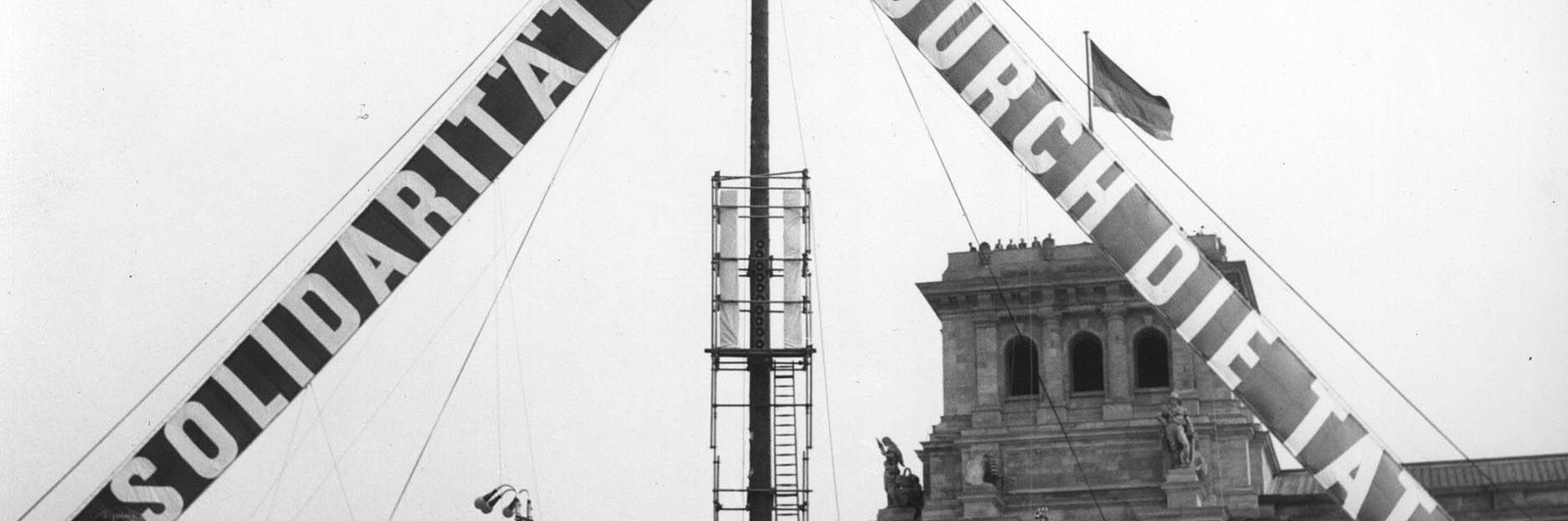
Workshop: »Hoch die internationale…«? – Praktiken und Ideen der Solidarität am 17./18. Oktober 2019 in Bonn
»Hoch die internationale…«? – Praktiken und Ideen der Solidarität
An Versuchen, den Solidaritätsbegriff theoretisch zu fassen, herrscht kein Mangel. Im ihm spiegeln sich zentrale säkulare und religiöse Deutungen moderner Gesellschaften. Vorstellungen von Solidarität verweisen auf die »moralische Ökonomie« kapitalistischer Gesellschaften, auf die Erfahrungen lebensweltlicher Nähe und politischer und sozialer Konflikte. Doch was genau der Begriff beschreibt, ob er zugleich analytische Qualität bei der Beschreibung sozialer Handlungsformen besitzt, ist umstritten. Merkwürdigerweise spielte der Begriff innerhalb der Geschichtswissenschaften bislang kaum eine größere Rolle. Solidarität ist Teil der Geschichte von Streiks, von Arbeitsbeziehungen, von Mikropolitiken im Betrieb, der Rolle der Gewerkschaften. In alltagsgeschichtlicher Perspektive verweist der Begriff auf Praktiken der Arbeit, auf Formen von Nähe und Distanz im Produktionsprozess und die Selbstdeutung der Beschäftigten. Er kann sowohl den Versuch zur kollektiven Organisation von Interessen beschreiben als auch ein primäres Gefühl des Zusammenhalts. Formen der Solidarität können zugleich einen exkludierenden Charakter haben, wenn beispielsweise Gewerkschaften gegen die Verlagerung von Betrieben oder gegen die Einfuhr spezieller Waren und Güter aus außereuropäischen Ländern stritten.
Die transnationale Dimension von Solidarität führt in das weite Feld organisierter Unterstützungsformen für Hungernde, Kriegswaisen, Geflüchtete oder politisch Verfolgte, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und sich in der Zwischenkriegszeit intensivierten. Diese transnationalen humanitären Netzwerke als Ausdruck solidarischer Praktiken zu analysieren, erschließt ihre genuin politische Dimension. Zu fragen wäre sowohl nach Formen der Selbstermächtigung als auch des widerständigen und transformatorischen Anspruchs unterschiedlicher Akteure und Organisationen. Der Solidaritätsbegriff verweist zudem in das weite Feld der Auseinandersetzung um »solidarische« Produktionsformen, betriebliche Kooperationen, Sharing Economy und Commons, die sich bewusst spezifischen Marktlogiken zu entziehen versuchen. Auch viele weitere Formen der Vergemeinschaftung wie zum Beispiel Sozialversicherungen, Konsumgenossenschaften, selbstorganisierte Wohnprojekte, Nachbarschaftshilfe und Urban Gardening werden mit Solidarität begründet.
Auf der Tagung, möchten wir ein Konzept für das hier skizzierte Rahmenthema des Archivs für Sozialgeschichte 60 (2020) entwickeln und mit eingeladenen Autorinnen und Autoren diskutieren
Zum Tagungsprogramm:
Donnerstag, 17.10.2019
Anreise und Anmeldung
Begrüßung und Einführung: Praktiken und Ideen der Solidarität
Philipp Kufferath, Bonn und Dietmar Süß, Augsburg
Ein fait social moderner Gesellschaften – oder: warum Solidarität kein ›Grundwert‹ ist
Hermann Josef Große Kracht, Darmstadt
Genese und Gegenwart der Kontingenzformel »Solidarität«
Marc Drobot, Dresden
Moderation: Kirsten Heinsohn, Hamburg
Kaffepause
Vorteile und Nachteile gelebter Solidarität. Russische Sekten 1861 – 1917
Agnieszka Zagańczyk-Neufeld, Bochum
»Künstlerhilfe« as an Example of the Alternative Way of the International Solidarity
Marija Podzorova, Paris
Solidarischer Stalinismus? Pierre Kaldor und die antifaschistischen, antikolonialen und innerkommunistischen Solidaritätskampagnen der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF), 1933-1995
Dominik Rigoll, Potsdam
Moderation: Thomas Kroll, Jena
Kaffeepause
Welches Geschlecht hat Solidarität? Der »Oeuvre de Secours aux Enfants« und die Hilfe für Minderjährige auf der Flucht vor dem NS
Sophia Dafinger, Augsburg
Über die Verrechtlichung von Solidarität. Die NIEO und die Entstehung einer neuen Menschenrechtsgeneration
Christoph Plath, Berlin
»Ausgleich zuhause und draußen.« Die Solidaritätsrhetorik in der bundesdeutschen und schwedischen Außenpolitik der 1970er Jahre
Christopher Seiberlich, Tübingen
Moderation: Ute Planert, Köln
Pause mit Imbiss
Abendveranstaltung
Globale Solidarität? Eine Geschichte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
Daniel Maul, Oslo, im Gespräch mit Dietmar Süß, Augsburg
Freitag, 18.10.2019
Beginn
Dynamische Solidarität. Praktiken der Solidarität in der Gesetzlichen Krankenversicherung und ihren Vorläuferorganisationen
Stefanie Börner, Magdeburg
Von Jesus zu Marx und zurück. Solidarität im Denken und gesellschaftlichen Wirken von Helmut Gollwitzer und Walter Dirks
Benedikt Brunner, Mainz/Gabriel Rolfes, Chemnitz
Unsolidarische Solidarität – Sprachpolitik im DGB
Stefan Wannenwetsch, Tübingen
Moderation: Meik Woyke, Hamburg
Kaffeepause
Solidarity across the Bamboo Curtain: The Networks of »Friendship with China« during the Cold War
Cyril Cordoba, Fribourg
The Afterlives of Solidarity: The »Solidaritätsdienst International« and its Re-Interpretation of the German Democratic Republic’s Programs of Global Development in Re-Unified Germany
Paul Sprute, Berlin
Internationale Solidarität und dekolonialer Widerstand im 21. Jahrhundert
Sebastian Garbe, Gießen
Moderation: Friedrich Lenger, Gießen
Mittagspause
Wandel der Solidarität. Semantiken von Solidarität beim politischen Konsum seit den späten 1980er-Jahren
Stefan Weispfennig, Trier
›Externe‹ Solidarität als kritische Praxis
Andreas Busen, Hamburg
Pitfalls of Solidarity: A Critical Perspective on the Refugee Support Movement
Joachim C. Häberlen, Warwick
Moderation: Anja Kruke, Bonn
Abschlussdiskussion
Ende des Workshops und Abreise
- Kontakt
- Redaktion
Das Archiv für Sozialgeschichte wird herausgegeben von
PD Dr. Kirsten Heinsohn
Prof. Dr. Friedrich Lenger
Prof. Dr. Thomas Kroll
Dr. Anja Kruke
Dr. Philipp Kufferath
Prof. Dr. Ute Planert
Prof. Dr. Dietmar Süß
Dr. Meik Woyke
Einzelveröffentlichungen
In der Reihe Einzelveröffentlichungen aus dem Archiv für Sozialgeschichte werden Aufsätze aus den Rahmenthemen publiziert.
Beihefte
In der ReiheBeihefte zum Archiv für Sozialgeschichte erscheinen vorwiegend Quelleneditionen mit Dokumenten zur Geschichte der Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung sowie zur Zeitgeschichte.